
Am 8. Februar 2018 titelte die Neue Zürcher Zeitung einen Artikel, der sich kritisch mit dem tags zuvor zwischen CDU/CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag befasste, mit der Überschrift „Mehr Staat – weniger Freiheit“. Hier interessiert weder der Koalitionsvertrag noch die Kritik daran. Ich möchte vielmehr Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse lenken auf den in dieser Überschrift unterstellten Zusammenhang zwischen Staat und Freiheit. Wenn dieser Überschrift ein quasi physikalisches Modell kommunizierender Röhren zugrunde liegt, dann gilt auch die Umkehrung „Weniger Staat – mehr Freiheit“, und es gilt auch die komparativische Formel „Je mehr Staat, desto weniger Freiheit“ sowie ihre Umkehrung. Dass diese Formeln das politische Credo vieler Zeitgenossen zum Ausdruck bringen, bedarf wohl keiner näheren Erklärung. Ich möchte mich im Folgenden der Frage zuwenden, welches Verständnis von Freiheit einerseits und Staat andrerseits sich in diesen einander ergänzenden Formeln manifestiert.
Die in Europa beheimatete politische Philosophie hat in einem langwierigen Diskussionsprozess das begriffliche Rüstzeug entwickelt, das geeignet ist, den Zusammenhang von staatlicher Macht und individueller Freiheit zu klären. Diesen Klärungsprozess will ich im Folgenden anhand einiger Stationen in Erinnerung rufen. Was Philosophen vorgedacht haben, wird im Gefolge langanhaltender Ständekämpfe und im Gefolge der großen Revolutionen von 1776 und 1789 zu praktischer Politik und geltendem Recht und führt – wenigstens in einigen Regionen dieses Planeten – zu einem Staatsgebilde, in dem die Freiheit des Einzelnen und die Macht des Staates neben- und miteinander bestehen können. Die Zahl der historischen Stationen, die jener Klärungsprozess durchlaufen hat, ist unüberschaubar. Die von mir getroffene Auswahl schließt zum einen Positionen ein, die als kanonisch gelten können; sie spiegelt zum anderen aber auch die philosophischen Vorlieben des Referenten.
-
Station: Aristoteles, oder: „Freiheit“ in der griechischen Polis
Vieles von dem, was wir heute mit Freiheit verbinden, ist in der Philosophie des Aristoteles angelegt, der ja nicht zu Unrecht auch als der Erfinder der Politischen Philosophie gilt. Es lassen sich in seiner Politik und seiner Nikomachischen Ethik eine Reihe von Aspekten unterscheiden, die sich dem Problemfeld der Freiheit zuordnen lassen, obwohl Aristoteles selbst hierfür noch keinen einheitlichen und übergreifenden Begriff benutzt. Ich will mich hier auf drei Aspekte beschränken:
Zum einen: Aristoteles kennt einen handlungsbezogenen Freiheitsbegriff: Negativ gesehen meint er das Handeln einer Person aus sich heraus, also ohne äußeren Zwang; positiv gesehen meint er die überlegte Entscheidung, die eine Person unter kluger Abwägung der problemrelevanten Aspekte einer Sache trifft. Dafür hat Aristoteles einen eigenen Ausdruck gefunden, den „mit Überlegung gefassten Entschluss“ (griech. prohaíresis).
Ein zweiter Freiheitsaspekt bezieht sich darauf, dass Menschen danach streben, genügend von dem zu haben, was für das bloße Überleben und für das gute Leben notwendig ist. Aristoteles benutzt dafür den auch uns heute noch als Fremdwort geläufigen Begriff der autarkeía, der Autarkie, der Selbstgenügsamkeit.
Und schließlich drittens: Für die Freiheit im rechtlichen und politischen Sinne gebraucht Aristoteles den Begriff der eleuthería. In ihrem Sinne ist frei, wer im Unterschied zum Sklaven nicht der naturgemäßen Lenkung durch einen Herren bedarf und deswegen um seiner selbst und um des guten Lebens willen existiert (zum Ganzen, vgl. Höffe 2014, S. 146 f.). Von dieser eleuthería her bestimmt Aristoteles nicht nur den Sklaven im Gegensatz zum Herren, sondern auch den Staatsbürger, den polítes. Was diesen vor anderen Bewohnern der Polis auszeichnet, ist, „dass er am Richten und an der Regierung teilnimmt“ (Pol. 1275a).
Zwischenfazit Nr. 1: Das erstmals seiner selbst bewusste politische Denken an seinem historischen Beginn in Griechenland kennt politische Freiheit nur im Bezug auf den Vollbürger einer kleinräumigen Polis, der an ihrer Gesetzgebung und ihrer Rechtsprechung Anteil hat. Diese Teilhabe hat jedoch zur ökonomischen Voraussetzung den Ausschluss der gesamten für die Polis arbeitenden Bevölkerungsmehrheit inklusive der Frauen von eben dieser Teilhabe. Seit langem streiten sich Philosophen, Historiker und Altphilologen miteinander und untereinander um die Frage, was dieses antike Freiheitskonzept mit neuzeitlichen Vorstellungen von politischer Freiheit gemeinsam hat. Und damit im Zusammenhang steht die alte Frage, ob die vor allem in Athen etwa zur Zeit des Perikles praktizierte Form der Demokratie Maßstäbe bereit hält für spätere Versuche, Herrschaftsausübung durch Teilhabe aller Bürger zu organisieren. Desungeachtet scheint jedoch wenigstens die Grundthese der aristotelischen Politik über die Zeiten hinweg ihre Gültigkeit behaupten zu können: Sie ergibt sich aus der fundamentalen anthropologischen Bestimmung des Menschen als eines zóon politikón, als eines politischen Lebewesens, und besagt, dass ein für den Menschen „gutes Leben“ nur in einer vom Gesetz bestimmten politischen Ordnung möglich ist.
-
Station: Der „Roland“, oder: „Stadtluft macht frei“
In der Nähe des Rathauses mancher Stadt, deren mittelalterliche Substanz nicht völlig dem Zweiten Weltkrieg oder späterer Bauwut zum Opfer gefallen ist, findet sich gelegentlich eine vollplastische Steinfigur, eine klobige Männergestalt in Kriegsrüstung mit einem bloßen Schwert in der rechten Faust. Es handelt sich um einen sog. „Roland“. Seinen Namen verdankt er einem der Grafen im Gefolge Kaiser Karls des Großen. Dessen Biograph Einhard berichtet in seiner vita des Kaisers vom Schicksal eben dieses Grafen, der die Nachhut des fränkischen Heeres anführte und in den Pyrenäen in einem Rückzugsgefecht von dem nachrückenden Feind getötet wurde, nicht ohne vor seinem Tod noch einmal mit seinem Horn um Hilfe geblasen zu haben. Das Letztere ist allerdings bereits die Zutat des im Mittelalter sehr populären Rolandsliedes. Die Rolandfigur war das Sinnbild der Eigenständigkeit einer Stadt, die das Marktrecht und eine eigene Gerichtsbarkeit besaß, und damit das Sinnbild einer spezifischen städtischen Freiheit. Diese besondere städtische Freiheit verdichtet sich in einem eigenen Rechtstitel, der gemeinhin mit der Formel „Stadtluft macht frei“ umschrieben wird. Die Formel selbst ist nicht mittelalterlich, wohl aber der Sachverhalt, der etwa im Stadtrechtsprivileg König Friedrichs II. für die Stadt Bern aus dem Jahre 1218 folgendermaßen umschrieben wird: Omnis homo qui venerit in hunc locum et remanere voluerit, libere sedebit et remanebit. Die deutsche Übersetzung des einschlägigen Artikels lautet: „Jeder Mensch, welcher an diesen Ort kommt und da bleiben will, soll frei sitzen und verweilen.“ (Strahm 1955, S. 103) Der Sachverhalt, um den es hierbei geht, ist – wie so häufig in der Geschichte – wesentlich komplizierter, als es die so eingängige Formel von der Stadtluft, die frei mache, vermuten lässt. „Luft“ meint die sprichwörtliche „Vergegenständlichung des Begriffes für Raum, Siedlungsraum, Ort der dauernden Niederlassung“ (Strahm 1955,S. 105). Die „Luft“ oder der Ort dauernder Niederlassung bestimmt – und das gilt bis heute – den Rechtsstatus des an diesem Ort Niedergelassenen. Und den eigentlichen Nutznießer dieses städtischen Privilegs nennt der lateinische Originaltext einen servus. Ein servus – die gängige Übersetzung als „Leibeigener“ klingt unnötig herabsetzend – ist im mittelalterlichen Verständnis des Wortes eine Person, die aufgrund ihres Geburtsstandes zu Diensten (lat. servitium) gegenüber einem (Grund)Herrn verpflichtet ist. Die Dienstverpflichtung konnte unterschiedliche Formen und Ausmaße annehmen. Sie bedeutete gleichwohl eine das Individuum unabweisbar und selbstverständlich bindende Verpflichtung. In der hierarchisch gegliederten Gesellschaft des Mittelalters konnte ein servus ganz unterschiedlichen Stufen angehören. Knechte und Mägde, die am Tisch des Dienstherrn aßen, weil sie keinen eigenen Herd besaßen, gehörten der sozial niedrigsten Stufe an. Die höchste Stufe bildeten die servi nobiles, die Ministerialen, die als Träger von Dienstlehen eine Lebensweise praktizieren konnten, die die Standesunterschiede zu den freien Adligen kaum mehr erkennen ließ. Aus allen sozialen Gruppen konnten also die servi stammen, die in die Stadt zogen und dort nach Jahr und Tag eines unangefochtenen Aufenthaltes von jedem Dienst gegenüber ihrem bisherigen Herrn befreit wurden.
Doch hatte diese Befreiung ihren Preis. Von den ohne oder mit Wissen und Willen ihrer Herren Zugezogenen verlangte die Stadt wie von jedem ihrer Bürger Dienstleistungen, die ihrem spezifischen Bedürfnis entsprachen: Als Stadtgenosse trat der Zugezogene in den Dienst des Stadtherrn. Er tauschte also das servitium, dessen er durch die Sesshaftigkeit in der Stadt ledig geworden war, ein gegen das neue servitium ebendieser Stadt, deren „Lieb und Leid“ – wie die alte Formel lautete – er hinfort mitzutragen hatte. Für den Schutz vor seinem bisherigen Herrn, den die Stadt ihm gewährte, schuldete er ihr Treue und Huld (fidelitas und homagium) sowie Dienst, also etwa Mitwirkung bei der Stadtverteidigung, und die Entrichtung von Abgaben. Die Freiheiten, die er im Gegenzug gewann, waren vielfältig und lokal differenziert. Eine der wichtigsten war, dass er das städtischerseits gewährte Schutzverhältnis jederzeit wieder aufgeben und anderswohin ziehen konnte und dennoch frei blieb von seinem früheren Herrendienst. Neben den individuellen Freiheiten profitiert der Zugezogene auch von jenen Freiheiten, die der Stadtbürgerschaft als Gesamtheit durch königliches Privileg zukamen, wie Mark-, Münz- und Zollfreiheit, die Freiheit nach eigenem Recht zu richten (immunitas) oder die sog. „Bestfreiheit“, das Recht, durch Ratsbeschluss neue Gesetze aufzustellen, zum allgemeinen Nutzen und zur Ehre der Stadt sowie zur Ehre des Reiches (pro communi utilitate et honore civitatis et honore imperii). Der letztgenannte Teil dieser Zweckbestimmung lässt erkennen, dass diese Freiheiten insbesondere den reichsunmittelbaren Städten zukamen, also jenen Städten, die „auf Reichsboden gegründet“ (fundus imperii) den König und Kaiser als unmittelbaren Herrn über sich hatten.
Zwischenfazit Nr. 2: Die überlieferten Quellen zur mittelalterlichen Stadtgeschichte zeigen mit Blick auf die Freiheit des Individuums ein auch dem modernen Betrachter nicht gänzlich unvertrautes Bild eines genau austarierten Zusammenspiels von Nehmen und Geben, von Leisten und Gewähren. Eine weitreichende Freiheit, unterfüttert mit weiteren Privilegien, ohne Rücksicht auf geburtsständische Dienstverpflichtungen erlangt derjenige, der sich dem Schutz der Stadt unterstellt und darüber hinaus die an diesen Schutz geknüpften Leistungen erbringt. Vor diesem Hintergrund ist vermutlich der erstaunlich klingende Satz eines seinerzeit nicht ganz unbedeutenden Althistorikers zu verstehen: „Der mittelalterliche Mensch war in vielem freier als der moderne, selbst wenn er Höriger war. Denn er stand nicht einem Staate gegenüber, der omnipotent ist, der polizeistaatliche Vorschriften für fast alle Lebensgebiete aufstellt.“ (Hölzle, S. 160)
3 Station: Sebastian Castellio, oder: Die Freiheit des Gewissens
Am 27. Oktober 1553 brennt ein Scheiterhaufen, am Pfahl der spanischstämmige Arzt und Humanist Miguel Servet. Ort des Geschehens ist das protestantische Genf, und ihr Initiator ist kein Geringerer als der führende Theologe der Stadt, Johannes Calvin. Servet war ein renommierter Arzt, der in Vienne am Hofe des dortigen Bischofs praktizierte, allerdings unter falschem Namen. In einer Zeit, in der Fragen des religiösen Bekenntnisses existentielle Bedeutung gewannen, hatte er sich als junger Mann auch mit theologischen Problemen beschäftigt und war für sich zu der damals unerhörten Überzeugung gekommen, dass die beim ersten ökumenischen Konzil von Nicäa (325) verkündete Trinitätslehre, die nicht nur für die römische Kirche, sondern auch für die Anhänger der Reformation unverbrüchlich galt, ein Irrtum sei. Die Abhandlung, in der er seine Überzeugung dargelegt und begründet hatte, stieß bei allen Theologen der Zeit, römischen wie protestantischen, auf schärfste Ablehnung. Ausgerechnet bei Calvin erhoffte sich Servet theologische Unterstützung für seine umstürzlerischen Thesen. Ein tragischer Irrtum! Fast noch unbegreiflicher ist jedoch ein zweiter Irrtum Servets: Auf der Flucht aus Vienne macht er ausgerechnet in Genf Station. Er wird erkannt, auf Betreiben Calvins verhaftet, verurteilt und hingerichtet, auf eine selbst für damalige Verhältnisse besonders grausame Weise. In einem zeitgenössischen Bericht von der Hinrichtung mit dem Titel Historia de morte Serveti steht der furchtbare Satz: „Einige beteuern, als Calvin gesehen habe, wie Servet zum Scheiterhaufen geführt wurde, habe er gelächelt und dabei den Blick hinter dem Bausch seines Gewandes leicht gesenkt.“ (Castellio 2013, S. 47) Die Historia fährt fort: „Dieses Geschehen hat viele fromme Menschen entsetzt und den Skandal der Skandale (scandalum scandalorum) ausgelöst, der wohl kaum jemals in Vergessenheit geraten wird.“ (Castellio 2013, ibd.) Schwere Vorwürfe gegen Calvin erhebt vor allem ein Zeitgenosse, der neun Jahre zuvor einer seiner Mitarbeiter in Genf gewesen war. Es ist dies der Humanist und Reformationstheologe Sebastian Castellio. Im März 1554, also wenige Monate nach den Geschehnissen in Genf, veröffentlichte Castellio unter dem Pseudonym Martinus Bellius ein kleines Buch mit dem Titel De haereticis an sint persequendi. Hierin wird mit aller Deutlichkeit die Verfolgung und Tötung Andersdenkender als unchristlich, ja als „widerchristlich, mit christlichen Argumenten nicht zu begründen“ (Castellio 2013, S. 60) verurteilt. Im Anschluss an die Veröffentlichung von De haereticis entwickelt sich wilder Streitschriftenkrieg zwischen den Anhängern Calvins in Genf und seinem Kontrahenten in Basel. Zum Fall Servet und zum grundsätzlichen Problem der Ketzertötung treten weitere Streitpunkte aus der Lehre Calvins, der sich schließlich in seiner theologischen Autorität bedroht sieht und nun seinerseits seinen Gegner mit allen ihm zu Gebote stehenden publizistischen Mitteln niederzukämpfen versucht. Diese publizistischen Auseinandersetzungen sind von einer Schärfe, wie man sie nur dort findet, wo Menschen ihre in langem Ringen gewonnenen Glaubensüberzeugungen gegen jegliche Form der Abweichung behaupten zu müssen glauben. Gegen seine Kritiker verteidigt sich Calvin Anfang des Folgejahres 1555 mit einer Defensio orthodoxae fidei [vollständig: de sancta trinitate contra prodigiosos errores Michaelis Serveti Hispani], die das strenge Vorgehen gegenüber Servet zu rechtfertigen versucht. Auf diese Defensio des Genfer Theologen antwortet wiederum Castellio mit einer ganz persönlich auf Calvin zielenden Streitschrift unter dem Titel: Contra libellum Calvini [, in quo ostendere conatur haereticos jure gladii coercendos esse]. Wieder wagt der Autor nicht, seinen eigenen Namen zu nennen, was ihn allerdings nicht vor der Nachstellung seiner Gegner zu schützen vermag. Immerhin ist ihr Einfluss groß genug, den Druck des Werkes zu verhindern. Dieses kann erst 1612 – und zwar in den republikanischen Niederlanden – gedruckt werden. Das Contra libellum Calvini hat die Form eines Dialogs zwischen Calvin und Castellio. Aus der umfangreichen Schrift Calvins hat Castellio für den Dialog eine Auswahl von längeren oder kürzeren Abschnitten getroffen, die er zunächst zitiert und dann kommentiert. Castellios Kritik hat mehrere Schwerpunkte. Sie richtet sich jedoch vor allem auf die von der Person Calvins unabhängige zentrale Frage, ob eine (christliche) Obrigkeit berechtigt sei, Ketzer zu bestrafen. Die Antwort Castellios findet sich in einer kurzen Passage, die mit dem Satz beginnt, der diesen Text so berühmt gemacht hat: Hominem occidere non est doctrinam tueri, sed est hominem occidere. „Einen Menschen töten, heißt nicht eine Lehre verteidigen, sondern einen Menschen töten.“ Es ist dieser eine Satz, der es verdient, allen religiösen Eiferern, Fanatikern und Fundamentalisten jeglicher Couleur und zu jeder Zeit ins imaginäre Stammbuch geschrieben zu werden. Und Castellio fährt fort: „Als die Genfer Servet getötet haben, haben sie keine Lehre verteidigt, sondern einen Menschen getötet. Die Lehre zu verteidigen ist nicht Aufgabe der Obrigkeit (was hat das Schwert mit der Lehre zu tun?), sondern die des Lehrers. Den Lehrer aber zu schützen ist Aufgabe der Obrigkeit, ebenso wie den Landmann, den Handwerker, den Arzt und andere gegen Unrecht zu schützen. Wenn daher Servet Calvin hätte töten wollen, dann hätte die Obrigkeit Calvin zu Recht verteidigt. Aber da Servet mit Argumenten und mit Schriften kämpfte, musste er mit Argumenten und Schriften widerlegt werden.“ (Gegen Calvin 2015, S. 131)
Zwischenfazit Nr. 3: Gegen ein hierarchisches, autoritäres und repressives Regime, das den Glauben an eine bestimmte Religion zur Pflicht macht und das Andersdenkende bzw. Menschen, die mit seinen ideologischen Grundpositionen nicht völlig übereinstimmen, als Ketzer, Häretiker und Apostaten unbarmherzig verfolgt, erhebt sich die Stimme eines Einzelnen, der ohne Rücksicht auf die damit für ihn selbst verbundenen Gefahren für Leib und Leben, die Freiheit der eigenen (Glaubens)Überzeugung einfordert. Stefan Zweig spricht in seiner romanhaften Ausgestaltung dieses Konflikts vom „Aufstand des Gewissens“. Sebastian Castellio ist nicht der einzige, der das politische Verlangen nach Gewissens- und Glaubensfreiheit formuliert und diese Forderung mit biblischen und theologischen Argumenten untermauert. Die adressierte Obrigkeit hat seine Forderung ebenso wie die anderer jedoch lange ignoriert. Verfolgungen wegen staatlicherseits missliebiger Glaubensüberzeugungen waren bis ins 18. Jahrhundert gang und gäbe, wenn die „Abweichler“ auch nicht mehr wie im Genf des Jahres 1553 verbrannt wurden. Erst allmählich und über viele historische Stationen der Glaubenskriege des 17. Jahrhunderts, der Aufklärung und schließlich der großen Revolutionen des 18. Jahrhunderts ist zumindest in Europa die Trennung von weltlicher und geistlicher Obrigkeit durchgesetzt worden und damit ineins die Sicherung der Glaubensfreiheit als einer „Herzensangelegenheit“ (Hobbes), die ausschließlich der Privatsphäre angehört.
-
Station: Thomas Hobbes, oder: Was legitimiert überhaupt den Staat?
Hobbes hat vor dem Hintergrund des von ihm selbst als tödliche Bedrohung erfahrenen konfessionellen Bürgerkriegs in England eine Staatskonzeption entwickelt, die unter einer bestimmten Hinsicht eine Limitation aller Freiheitsbestrebungen des Einzelnen bedeutet und die gleichzeitig unter einer anderen Hinsicht die Freiheit des Einzelnen überhaupt erst konstituiert. Das klingt paradox und bedarf der Erläuterung: Zwei berühmte Formeln charakterisieren den Einzelnen und das Verhältnis der vielen Einzelnen zueinander in einem vorstaatlichen Gesellschaftszustand, dem sogenannten „Naturzustand“, der zwar ein quasi mathematisches Konstrukt ist, der aber im konfessionellen Bürgerkrieg im England des 17. Jahrhunderts so etwas wie ein empirisches Pendant gefunden hat. Die erste Formel ist das berühmt-berüchtigte homo homini lupus, „der Mensch ist dem Menschen ein Wolf“, die zweite die nicht minder berühmt-berüchtigte vom bellum omnium contra omnes, vom „Krieg aller gegen alle“. Sie gehören zusammen und bedeuten Folgendes: Aus Gründen der Selbsterhaltung ist jeder Einzelne genötigt und berechtigt, jeden anderen als Konkurrenten, als Gegner, als potentiellen Feind anzusehen und zu behandeln, der ihm an sein Gut und im Extremfall ans Leben will. Aus diesem anthropologischen Grunddatum resultiert eine Gesellschaft, in der zwar nicht notwendigerweise ständig offener Krieg herrscht, in der aber jeder ständig auf der Hut sein muss, weil die permanenten latenten Konflikte jederzeit in offene Gewalt umschlagen können. Dies führt – wie Hobbes nicht müde wird zu betonen – zu einem elenden Leben. So gebietet es die an Selbsterhaltung interessierte Vernunft dem Menschen, einen Ausweg aus diesem Elend zu suchen. Und der Staat ist eben der von der Vernunft gefundene Ausweg. Dafür muss er allerdings auf eine ganz bestimmte Weise zustande gekommen sein.
Im berühmten Titelkupfer zu seinem staatsphilosophischen Hauptwerk, dem „Leviathan“, aus dem Jahre 1651, – Sie haben es alle schon einmal in Ihren jeweiligen Schulgeschichtsbüchern gesehen – , hat Hobbes die Erzeugung dieses Staates bildkräftig umgesetzt: In der oberen Hälfte des zweigeteilten Emblems steigt über einer wohlgeordneten und friedlichen Landschaft mit einer befestigten Stadt und vielen kleinen Dörfern eine riesige Männergestalt aus dem Meer. Sie trägt auf dem Kopf eine Krone, in der rechten Hand das Schwert als Sinnbild der weltlichen Gewalt und in der linken den Krummstab als Sinnbild der geistlichen Gewalt. Der Oberkörper dieser Männergestalt aber ist, wenn man genauer hinsieht, nach dem Vorbild des berühmten italienischen Manieristen-Malers Giuseppe Arcimboldo zusammengesetzt aus lauter kleinen Menschlein zu einem künstlichen Menschen. Das ist die bildhafte Umsetzung des Vertragsgedankens, auf dem die Erzeugung des Staates nach Hobbes basiert. Jeder Einzelne überträgt die ihm im Naturzustand zustehende Gewaltbereitschaft auf einen Dritten unter der Bedingung, dass jeder andere zur gleichen Verzichtleistung bereit ist. Auf diesem Wege erhält dieser Dritte die gebündelten Gewaltpotentiale aller Individuen zugesprochen. Seine Macht wird dadurch nahezu grenzenlos, und Hobbes bezeichnet ihn deswegen mit dem aus dem Alten Testament entlehnten Namen als den „Leviathan“, den „sterblichen Gott“. Die im Staat gebündelte Macht ist zwar absolut, aber sie dient letztlich nur einem einzigen Zweck, dessen Erfüllung zugleich seine letzte Legitimation bedeutet, nämlich dem Schutz und der Sicherheit der Menschen, die sich unter sein Dach begeben haben. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch: Wenn der Staat diese Sicherheit nicht mehr gewährleisten kann, dann verliert er seine Berechtigung, und die bisherigen Bürger sind nicht nur genötigt, sondern auch berechtigt, ihre Sicherheit wieder in die eigenen Hände zu nehmen.
Zwischenfazit Nr. 4: Sicherheit für Gut und Leben ist eine der konstitutiven Bedingungen zur Wahrnehmung aller Freiheiten. Diese Einsicht verdanken wir dem englischen Philosophen Thomas Hobbes, der dem durch Vertrag zustande gekommenen Staat unabhängig von der jeweils realisierten Regierungsform alle Macht zuspricht, damit er im Interesse aller seiner Bürger jegliche Form von Selbstjustiz unterbinden kann.
-
Station: Immanuel Kant, oder: Die zwei Freiheiten
Freiheit ist das zentrale Thema der theoretischen wie auch der praktischen Philosophie des Königsberger Aufklärers. Im Rahmen dieses Vortrags können dazu allerdings nur einige Hinweise gegeben werden. Auf Kant geht letztlich auch die bis heute heftig diskutierte Unterscheidung von negativer und positiver Freiheit zurück. Diese Unterscheidung hat eigentlich zwei unterschiedliche Freiheitsprobleme zur Voraussetzung. Das erste hat mit der Freiheit als Rechtsbegriffs zu tun, das zweite mit der Freiheit als Idee. Freiheit als Rechtsbegriff ist gleichbedeutend mit politischer Freiheit. Freiheit als Idee hat hingegen eine umfassendere Bedeutung, die vor allem in der Moralphilosophie zum Tragen kommt. Den Rechtsbegriff der Freiheit bestimmt Kant in seiner Spätschrift Die Metaphysik der Sitten (1797) folgendermaßen: „Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann.“ (Kant, MS, S. 337; A 33). Freiheit in diesem Sinne meint die Unabhängigkeit von jedem Zwang, den andere oder der Staat auf eine Person ausüben. Kant spricht von dieser Freiheit als der „Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür“ und nennt sie das „einzige, ursprüngliche, jedem Menschen, kraft seiner Menschheit, zustehende Recht“ (Kant, MS, S.345; AB 45). Das aber gilt als negative Bestimmung der Freiheit, denn sie ist bestimmt als Abwesenheit von jeglichem Zwang. Die politisch-rechtliche Dimension der Freiheit fasst Kant demnach auf als einen nicht näher bestimmten Freiraum, in dem sich jeder einzelne unabhängig von jedem anderen entfalten kann. Zum Rechtsbegriff der Freiheit gehört es aber nicht, genauer zu bestimmen, wie nun der einzelne innerhalb dieses Freiraums seine Freiheit nutzt bzw. nutzen sollte. Das aber hat schwerwiegende Konsequenzen: Denn Handlungen des einen, die eigentlich nur dem Gebrauch der eigenen Freiheit dienen sollen, können für einen anderen zum Hindernis für dessen Freiheit werden. Kant sieht die Lösung dieses Problems in einem allgemeinen Gesetz, wenn er schreibt: „Also ist das allgemeine Rechtsgesetz: handle äußerlich so, dass der freie Gebrauch deiner Willkür mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen könne [ … ]“ (Kant, MS, S. 338; A 34). Mit dem hier apostrophierten „allgemeinen Rechtsgesetz“ sieht Kant die widerspruchsfreie Möglichkeit gegeben, denjenigen, dessen Handeln für andere ein Hindernis ihrer Freiheit ist, zu zwingen, dieses Handeln aufzugeben. Der Paragraph, in dem dieser durch das Recht selbst gerechtfertigte Zwang ausbuchstabiert wird, trägt denn auch die bezeichnende Überschrift: „Das Recht ist mit der Befugnis zu zwingen verbunden.“ (Kant, ibd.). Diese Befugnis des Rechts zu zwingen, endet jedoch nach Kant da, wo der andere Freiheitsbegriff ins Spiel kommt, die Freiheit als Idee. Sie besagt kurzgefasst: Der Mensch ist als Vernunftwesen prinzipiell fähig, sich in seinem Wollen und Handeln an dem von der praktischen Vernunft gebotenen Sittengesetz auszurichten. Seiner Form nach ist dieses Sittengesetz identisch mit dem Kategorischen Imperativ, dessen erste Formulierung so lautet: „handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ (Kant, GMS, S. 52). Nun wäre es zweifellos wünschenswert, wenn alle Menschen gemäß dem Sittengesetz handelten. Doch eben die Idee dieser Freiheit verbietet es strikt, dass etwa ein Gesetzgeber die Bürger seines Staates zu einem moralischen Handeln zwingt. Kant schreibt dazu in seiner Spätschrift Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793): „Weh aber dem Gesetzgeber, der eine auf ethische Zwecke gerichtete Verfassung durch Zwang bewirken wollte! Denn er würde dadurch nicht allein gerade das Gegenteil der ethischen bewirken, sondern auch seine politische untergraben und unsicher machen.“ (Kant, RGV, A 124)
Fazit Nr. 5: Die politische Philosophie hat flankiert von der Moralphilosophie in der Aufklärung ein Konzept von Freiheit entwickelt, in dem die Freiheit des Einzelnen mit dem allgemeinen Gesetz verbunden wird. Freiheit verträgt sich auch außerhalb der religiösen Sphäre mit einer Unterordnung unter das Gesetz, solange der Einzelne als ein freies Wesen sich einer von ihm selbst gewählten Gesetzmäßigkeit unterwirft. Den Willen, der ihn dazu antreibt, bezeichnet Kant in Anlehnung an seine Vorstellung von der Naturkausalität als „eine Art von Kausalität lebender Wesen, sofern sie vernünftig sind“ (Kant, GMS, S.83) Es klingt paradox: Aber die Freiheit von der Naturkausalität wird von Kant gleichwohl als Kausalität verstanden, als freier Wille, der sich gemäß seiner Vernünftigkeit selbst Gesetze gibt.
-
Station: Karl Marx, oder: Die „Versöhnung“ von Individuum und Gesellschaft in der gesellschaftlichen Arbeit?
Der genius loci nötigt dazu, dem Philosophen Reverenz zu erweisen, in dessen Geburtsstadt und in dessen 200. Geburtsjahr wir uns hier und heute befinden. Wie steht es also mit der individuellen Freiheit bei Karl Marx? Bis zur Revolution von 1848 hat Marx als Journalist und Redakteur in einem Blatt für „Politik, Handel und Gewerbe“ radikal liberale Positionen vertreten. Sie kritisieren vehement alle Relikte einer mittelalterlichen Ständeordnung, wo der Zufall der Geburt über Vor- und Nachteile zu Beginn des Lebenswegs eines Menschen entschied: ob adelig, bürgerlich oder bäuerlich, ob wohlhabend oder besitzlos, ob auserwählt oder verdammt, je nach Stand, Ethnie, Religion, somit also nach der Zugehörigkeit zu Kollektiven. Liberale wie Marx kämpften demgegenüber für eine Gesellschaft, in der die individuelle Disposition aus Talent und Fleiß und ihre selbstbestimmte Verwirklichung schicksalsbestimmend sein sollten.
Doch auch nachdem Marx längst Sozialist geworden war, im Jahre 1875, übte er heftige Kritik an einem Parteiprogramm der eben im Entstehen begriffenen deutschen Sozialdemokratie mit Argumenten, hinter denen man eher eine liberaldemokratische Partei (Marx spricht von „Freihandelspartei“) vermuten möchte. So mokiert er sich beispielsweise darüber, das sozialdemokratische Parteiprogramm sei unter dem Einfluss seines alten Kontrahenten Ferdinand Lassalle „durch und durch vom Untertanenglauben der Lassalleschen Sekte an den Staat verpestet“ (Marx / Engels, Bd. 19, S. 31). Auch der späte Marx bleibt ein vehementer Kritiker des Staates, der ihm als „Zwangsapparat“ suspekt ist, inklusive seines Rechts- und Strafsystems, seiner Polizei und seiner Bürokratie. Der gedankliche Hintergrund dieser scharfen Kritik aus den späteren Jahren ist allerdings nicht mehr ein liberaler. Marx’ liberale Hoffnungen waren 1848 zerstoben, nachdem eine bürgerlich-demokratische Revolution, schlecht vorbereitet und dilettantisch umgesetzt, in Europa gescheitert war. Allerdings wollte Marx auch verhindern, dass der sich parteipolitisch formierende Sozialismus hinter einen Liberalismus zurückfiele. Im Hintergrund steht vielmehr die Vorstellung, dass „Individuum“ und „Gesellschaft“ gar nicht die unversöhnlichen Gegensätze repräsentieren, als die sie manchem Liberalen erscheinen. Der Einzelne, ausgestattet mit Rechten und Chancen der Teilhabe, wird hervorgebracht von einer bestimmten Gesellschaft, in der Arbeitsteilung ebenso wie Produktion und Reproduktion der Lebensgrundlagen in großem Maßstab herrschen, wie das für die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert, aber auch für einen digital vernetzten Weltmarkt im 21. Jahrhundert gilt. Dieser Einzelne jedoch bedarf des Reichtums und der Kultur für seine Existenz. „Quelle des Reichtums und der Kultur“, schreibt Marx in seiner Kritik des Gothaer Programms, werde die Arbeit, allerdings nicht als „vereinzelte Arbeit“, die zwar „Gebrauchswerte“ schaffen könne, aber „weder Reichtum noch Kultur“, sondern nur „als gesellschaftliche Arbeit“ oder, was dasselbe sei, als Arbeit „in und durch die Gesellschaft“ (Marx / Engels, Bd. 19, S. 17). Der Kapitalismus allerdings pervertiert, nach Marx, den Nutzen der gesellschaftlichen Arbeit. Denn ebenso unstrittig wie der Satz, dass die gesellschaftliche Arbeit „Quelle des Reichtums und der Kultur“ sei, sei eben auch der „andre Satz“: „In dem Maße, wie die Arbeit sich gesellschaftlich entwickelt und dadurch Quelle von Reichtum und Kultur wird, entwickeln sich Armut und Verwahrlosung auf Seiten des Arbeiters, Reichtum und Kultur auf Seiten des Nichtarbeiters.“ (Marx / Engels, Bd. 19, ibd.) Erst in der von Marx für möglich gehaltenen kommunistischen Gesellschaft sollte sich auch die von der gesellschaftlichen Arbeit erwartete individuelle Freiheit einstellen. In dieser Gesellschaft der „Assoziation freier Individuen“ genießt jeder Einzelne die Abwesenheit von Zwang ebenso wie die Verfügung über die eigene Lebenszeit, die es ihm erlaubt – wie die berühmt gewordene Formulierung schon des jungen Marx lautet – „heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, Abends Viehzucht zu treiben nach dem Essen zu kritisieren, [ … ], ohne je Jäger Fischer Hirt oder Kritiker zu werden“ (MEGA I/5, 2017, S. 33).
Zwischenfazit Nr. 6: Man streitet immer noch, auch angefeuert durch das heurige Jubiläumsjahr, wie weitsichtig und tragfähig Marx’ Analysen der langfristigen ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung sind. Marx’ Optimismus hinsichtlich der Überwindung aller mit der kapitalistischen Produktionsweise einhergehenden Übel in der „Assoziation freier Individuen“ speiste sich aus der Hoffnung, dass der Kapitalismus an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde gehen werde. Diese Prognose hat sich noch nicht bewahrheitet. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und wenn es nicht gelingt, die mit der kapitalistischen Produktionsweise einhergehende Zerstörung der Natur umzukehren, dann hat Marx immer noch gute Chancen recht zu behalten. Allerdings gäbe es dann niemanden mehr auf diesem Planeten, der ihm das bestätigen könnte.
-
Station: Hannah Arendt, oder: Was ist Freiheit, und was bedeutet sie uns?
Vor einigen Monaten erschien aus dem Nachlass von Hannah Arendt, der bedeutendsten Vertreterin der politischen Philosophie im 20. Jahrhundert, ein Essay mit dem Titel „Die Freiheit, frei zu sein“. Er wurde erst 2017 entdeckt, stammt aber, wie auf dem Manuskript vermerkt ist, aus den Jahren 1966/67 und diente wohl als Grundlage für einen Vortrag. Ob dieser je gehalten wurde, ist nicht bekannt.
Über weite Strecken geht es in diesem Essay um einen Vergleich zwischen der Amerikanischen Revolution von 1776 und der Französischen Revolution von 1789. Die Rede ist vom Gelingen der ersteren und dem Scheitern der letzteren sowie von der paradox anmutenden Erkenntnis, dass die gelungene allenfalls lokale Resonanz gefunden habe, während die gescheiterte bestimmend geworden sei für unser Verständnis von Revolution überhaupt. Doch gegen Ende ihrer Überlegungen formuliert Arendt einen überraschenden Gedanken, der sich vor allem gegen jeglichen Pessimismus richtet, dem man so leicht erliegt, wenn man sich die Geschichte insgesamt und die Geschichte der Revolutionen im Besonderen vor Augen führt: Im Rückgriff auf die berühmte vierte Ekloge des römischen Dichters Vergil, die mit der Herrschaft des Augustus den Beginn eines neuen Zeitalters feiert, deutet Arendt diesen Text als eine „Geburtshymne“, die „die Geburt als solche preist, [ … ] das große rettende [ … ] ‚Wunder’, das die Menschheit ein ums andere Mal erlösen wird“. (Arendt 2018, S. 21 f.) Arendt verbindet diesen Gedanken des mit jeder Geburt einhergehenden Neubeginns mit ihrer anthropologischen Grundüberzeugung, dass die Fähigkeit zum Handeln den Menschen zu einem politischen Wesen mache. Handeln aber bedeute, etwas Neues zu beginnen, das zuvor nicht da war. Und dass wir als Menschen diese Fähigkeit besitzen, hat für Hannah Arendt „offenkundig etwas damit zu tun, dass jeder von uns durch die Geburt als Neuankömmling in die Welt trat. Mit anderen Worten: Wir können etwas beginnen, weil wir Anfänge und damit Anfänger sind.“ (Arendt 2018, S. 22).
Zwischenfazit Nr. 7: Hannah Arendts Gedanke, dass mit der Geburt eines jeden Menschen ein zwar kleiner, aber gleichwohl alles Bisherige hinter sich lassender Neuanfang gemacht ist, hat etwas Aufrüttelndes. Er eröffnet die Freiheit, sich von dem vermeintlich längst Bekannten abzuwenden und etwas Neues zu wagen, zunächst im Denken und dann vielleicht auch im Tun. Insofern erinnert dieser Gedanke auch an das berühmte dem römischen Dichter Horaz entlehnte Motto aus Kants „Aufklärungsaufsatz“ vom sapere aude, von dem Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.
Schluss
Staatliche Gewalt tendiert strukturell zur Übergriffigkeit gegenüber dem Einzelnen, entweder positiv: paternalistisch, bevormundend, oder negativ: kontrollierend, gängelnd. Deswegen muss staatliche Gewalt gezähmt werden. Die Freiheit des Einzelnen tendiert strukturell zur Übergriffigkeit gegenüber den Freiheitsansprüchen anderer. Deswegen muss die Freiheit des Einzelnen eingehegt werden. Dieser teils latente, teils manifeste Konflikt zwischen der Selbstbehauptung des Individuums und der Übergriffigkeit der Staatsmacht, der jahrhundertelang die Geschichte Europas durchwirkte, hat im Laufe des 20. Jahrhunderts seine „Lösung“ gefunden in der Gestalt des liberalen und demokratischen Rechtsstaates. Der liberale und demokratische Rechtsstaat, der, auch inspiriert durch jahrhundertlange Bemühungen einer politischen Philosophie, in lange währenden politischen Auseinandersetzungen Gestalt gewonnen hat, bringt mit sich eine bis dahin nie erreichte Balance von individueller Freiheit und Macht des Staates. Ein Garant dieser Balance ist die Verfassung. Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland einmal als einen „besonderen Glücksfall der deutschen Geschichte“ bezeichnet (Sendereihe WDR 3 „Das Grundgesetz geht alle an!“ 2017). Und man muss eigentlich nur noch einmal die wenigen Seiten des Grundrechtsteils des Grundgesetzes, mit der Präambel und den ersten 19 Artikeln, mit Bedacht lesen, um sich dieser Einschätzung anschließen zu können. Ich sage das nicht etwa als deutscher Beamter, der zur Loyalität gegenüber dem Staatswesen verpflichtet ist, dem er seine Alimentation verdankt, sondern ich sage das als jemand, der – mit Kant zu sprechen – von seiner Vernunft öffentlichen Gebrauch macht. Für unser Thema erscheinen mir insbesondere vier Aspekte der Erinnerung wert:
- Die Fundierung des gesamten Verfassungswerkes in dem aus der religiösen und philosophischen Tradition des Abendlandes entlehnten normativen Konzept der „Würde des Menschen“, die Art. 1 (1) GG für „unantastbar“ erklärt.
- Die Auflistung der jedem Bürger zustehenden Grundrechte, angefangen von der freien Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 GG) bis hin zum Petitionsrecht (Art. 17 GG).
- Die alle Staatsgewalten bindende Vorschrift, dass keines der Grundrechte jemals „in seinem Wesensgehalt angetastet werden“ dürfe (Art. 19 (2) GG).
- Der Abschluss des Grundrechtsteils durch das formelle Hauptgrundrecht, das jedem einen lückenlosen gerichtlichen Rechtsschutz garantiert gegenüber Eingriffen der öffentlichen Gewalt, die er als rechtswidrig empfindet. (Art. 19 (4) GG).
Der Ausdruck „Glücksfall“ meint aber vielleicht nicht nur die Qualität des Verfassungswerkes, sondern darüber hinaus den „glücklichen Umstand“, als Bürger in ein Staatswesen hineingeboren worden zu sein, das durch eine solche Verfassung geschützt wird. Glück im Sinne der Fortuna ist aber auch – wie wir alle immer wieder erfahren – launisch. Und insofern erinnert der Ausdruck auch daran, dass die von der Verfassung zwar geschützte, niemals aber endgültig sicherzustellende Balance von individueller Freiheit und Staatsmacht fragil und zerbrechlich ist. Nur die beständige und aktive Anteilnahme der Bürger an den sie selbst und den Staat insgesamt angehenden Geschäften vermag diese Balance auf Dauer zu erhalten. Denn die aktuelle Realität dieser demokratisch-rechtsstaatlichen „Lösung“ ist historisch und geographisch eng begrenzt. Und sie steht überdies in harter Konkurrenz zu vielfältigen Formen autokratischer Staatsgewalt, denen die Macht oligarchischer Eliten viel und die Freiheit der Einzelnen wenig bedeutet. Wir sollten uns stets dessen bewusst bleiben, dass dieser Zustand global betrachtet das Resultat eines Sonderweges ist. Die meisten Staaten dieser Erde kennen de facto keine Garantie individueller Freiheitsrechte, sie kennen keine Gewaltenteilung, sie kennen keine Trennung von Religion und Staat, und ihre politisch Verantwortlichen sehen das von uns Erreichte noch nicht einmal als für sich wünschenswert an. Der in Zürich lehrende Historiker Bernd Roeck schreibt hierzu: „Das alte Utopia ist für einen historischen Moment nicht mehr das Anderswo, es ist die an einigen wenigen glücklichen Landstrichen verwirklichte liberale, demokratische und rechtsstaatliche Gesellschaft. Die Weltgeschichte hat an diesem Projekt Jahrtausende gearbeitet. Unvorstellbar viel Blut wurde vergossen; [ … ]. Verglichen mit dem, was die Geschichte an Alternativen hervorgebracht hat, erweist sich bis heute die westliche Zivilgesellschaft tatsächlich als beste aller möglichen Gesellschaften.“ (Roeck 2009, S. 16)
63. Internationales Jahrestreffen des SIESC



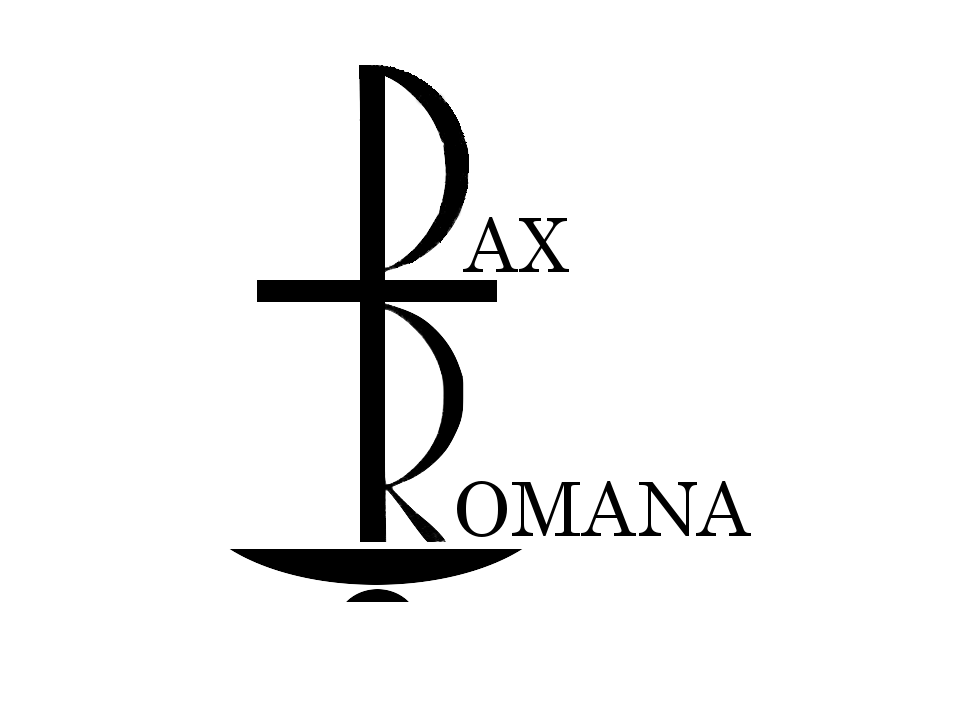

Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.